Der zweite Teil der diesjährigen Infosocietydays gehörte dem Swiss eHealth Forum. An einem Tag ging es um das Elektronische Patientendossier EPD, dessen politische Fragen und welche Probleme es immer noch ausbremsen. Der zweite Tag beleuchtete, vor welchen Herausforderungen die Spitäler mit ihren Informationssystemen stehen und warum die Branche sich so langsam wandelt.
Der erste Tag des Swiss eHealth Forum stand unter dem Oberthema «Digitale Transformation mit EPD, eHealth und mHealth», wobei das EPD klar die erste Geige spielte. Dabei standen sich zwei konträre Haltungen gegenüber. Die einen sehen das Problem darin, dass die PatientInnen den Nutzen einer digitalen Krankenakte erkennen sollten und dass das Eröffnen eines EPD leichtgemacht werden muss. Dies kam unter anderem im Votum von Michael Jordi, Zentralsekretär der Schweizerischen Gesundheitsdirektoren Konferenz GDK, zum Ausdruck, aber auch in Fragen aus dem Publikum. Die andere Sicht zeigt die ÄrztInnen im Zentrum. Keine Weisung hilft, so sagte Roland Naef, Bereichsleiter Medizinische Applikationen & Services am Universitätsspital Zürich, wenn für sie, beziehungsweise auch für die Gesundheitsversorgung an sich, ein substanzieller Nutzen entsteht. Zu dicht gedrängt ist das Arbeitsprogramm im Spital, als dass die Leistungsträger Zeit für etwas aufwenden würden, das für sie und ihre Arbeit keinen Nutzen bringt.
Daten oder Dokumente
Es ging aber nicht nur um die Frage Patient oder B2B, sondern auch um die Frage digitale Daten oder digitale Dokumente. Das EPD ist ein Dossier für Dokumente. Roland Naef kritisierte das, denn aus seiner Sicht kommt der eigentliche Nutzen erst mit den Daten. Diese Diskussion wird uns noch einige Jahre erhalten bleiben.

Geld, Sicherheit und IAM
Vieles dreht sich ums Geld, das wurde unter anderem im Vortrag von Richard Patt, Geschäftsführer Verein eHealth Südost, thematisiert. Die Kosten der EPD-Einführung sind leider beträchtlich. Im Mobile Health ist die fehlende Vertrauenswürdigkeit der Apps ein Problem, sowohl was die medizinische Richtigkeit als auch was den Datenschutz betrifft, das zeigte Urs-Vito Albrecht von der Medizinischen Hochschule Hannover auf. Und ein Hauptproblem im Spital ist das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM = Identity and Access Management), das zeigte Roland Naef auf. PatientInnen kommen mit ihren Gesundheits-Apps ins Spital und täglich werden im Spital selber Apps eingeführt. Das führt dazu, dass für jede Patientin, jeden Patienten unterschiedliche elektronische Identitäten existieren und miteinander verknüpft werden müssen.
Im Westen nichts Neues
Apropos IAM: Die SwissID gab ebenso ein Gastspiel wie die Blockchain – erstere nach dem Brecht‘schen Motto „alle Fragen offen“, letztere mit der ungeklärten Frage, wer denn so vertrauenswürdig ist oder gar ganz böse aktiv etwas manipulieren möchte an den Patientendaten. Falls es noch eines Beweises bedurfte: Die Menschen hören es gern, dass alles gut wird mit SwissID und Blockchains.
Kunde oder Patient
So viel Glauben an ihre Zukunft würden sich andere wünschen. Der Vortrag von Fabian Vaucher, Geschäftsführender Präsident des Schweizerischen Apothekerverbands pharmaSuisse, drehte sich mehr oder weniger indirekt um die Existenzrechtfertigung der extramuralen Apotheker. Sie bieten einen niederschwelligen Zugang zur Gesundheitsversorgung, vergütet wird ihnen aber Angabe von Medikamenten, die es im Internet billiger gibt. Vaucher versuchte diese Situation positiv auszuleuchten, in dem er betonte, dass in der Apotheke der Patient vor allem Kunde sei und die Dienste auf Augenhöhe mit dem Kunden angeboten würden. Bei einigen der anwesenden ÄrztInnen kam das erwartungsgemäss ganz schlecht an, weil sie Patienten nicht als Kunden ansehen.
Testen, testen, testen
Die positivste Botschaft kam von Adrian Schmid, Leiter eHealth Schweiz: Es wird viel, ganz viel getestet und die technischen Spezifikationen werden erst danach erstellt werden. Das ist eine gute Nachricht – endlich wird es ernst mit dem Patientendossier.
Versicherer sollten in EPD investieren

Felix Schneuwly
Der zweite Tag des eHealth-Forums widmete sich der Zukunft des Klinikinformationssystems (KIS). Einige Referenten übten Kritik, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen viel zu langsam voranginge. Bisher würden vor allem Spitäler und niedergelassene ÄrztInnen in die Pflicht genommen, «doch eigentlich müssten die Versicherer Treiber sein und nicht nur Zahlstellen», sagte Felix Schneuwly, Head of Public Affairs bei Comparis. Die Krankenversicherer sollten sich wirklich überlegen, ob sie ins EPD investieren. «Auch wenn sie nicht direkt an die Daten der PatientInnen kommen, werden sie dennoch vom EPD profitieren», ist sich Schneuwly sicher. Und zum Abschluss seines Keynotes will Schneuwly zwar «kein Politikbashing» machen, aber er moniert: «die Politik könnte mehr tun».
Spitäler zu geizig bei Digitalisierung
Auch Jürg Blaser, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Informatik und Professor am Universitätsspital Zürich kritisierte einerseits die Politik. Der Föderalismus trage eine Mitschuld am Schneckentempo. Andererseits nahm Blaser auch die Spitäler in die Pflicht: „Spitäler investieren nur etwa 2 Prozent ihres Budgets in die Digitalisierung ihrer Prozesse». Dies solle sich ändern, wenngleich er befürwortete, dass das Gesundheitswesen die Risiken der technischen Entwicklungen gründlich abwäge. Chancen sieht Blaser etwa in der Mustererkennung bei der medizinischen Bildgebung. Zudem solle die Hoheit bei den Daten bei den PatientInnen liegen.
KIS krankt an schlechter Usability

Martin Pfund
Eine der grössten Herausforderungen der Gesundheitsbranche sind die Klinikinformationssysteme (KIS) der Spitäler, mit deren Zustand die wenigsten Ärztinnen zufrieden sind. Zwei Referenten zeigten auf, woran es hapert und was verbessert werden müsste. «Das KIS ist zwar das wichtigste Instrument in Spitälern, hat aber zu viele Problemstellen, als dass es effizient nützt», sagte Martin Pfund, CIO vom Kantonsspital Graubünden, und benannte die oft schlechte Usability, fehlende Schnittstellen zu spitalinternen Partnersystemen und fehlende Funktionen.
Mehr Kreativität bei den Entwicklern
Pfund kritisierte die Spitäler, die zu wenig finanzielle und personelle Ressourcen für die Digitalisierung einsetzten, aber auch die IT-Hersteller, die mehr Kooperationen eingehen und schneller reagieren sollten. Die IT-Anbieter sollten kreativer werden, Modelle unter anderem für Managed Services entwickeln und bei allen neuen Entwicklungen endlich den Patienten ins Zentrum stellen, forderte Pfund. Die strategische Ausrichtung des KIS sei die zentrale Frage der nächsten Jahre. «Wir am Kantonsspital Graubünden setzen auf ein homogenes KIS, das alle Prozesse im Spital verbindet und auch kliniknahe Bereiche wie Labors und Radiologie anbindet», sagte Pfund.

KIS besser an externe Datenquellen anbinden
Herausforderungen beim KIS 4.0 sieht Michael Lehmann, Arzt und Professor für Medizininformatik am TI der Berner Fachhochschule, unter anderem bei der Systemarchitektur und der semantischen Interoperabilität. «Es braucht eine 360-Grad-Sicht der Patientendaten, einheitliche Stammdaten und Metadaten, die Kontext und Ort enthalten», sagte Lehmann. Profitieren würde das KIS auch durch die Einbindung von Daten, die die PatientInnen durch kontinuierliche Messungen via Apps und Wearables generierten. «Als Arzt sieht man PatientInnen nur fünf Minuten und macht eine einzelne Messung, um eine Diagnose zu stellen, dabei gibt es womöglich Daten über die restlichen Stunden.» Generell sprach sich Lehmann für sinnvolle Verknüpfungen mit spitalinternen und -externen Datenquellen aus, um ein möglichst vollständiges Bild der PatientInnen zu ermöglichen
 Create PDF
Create PDF






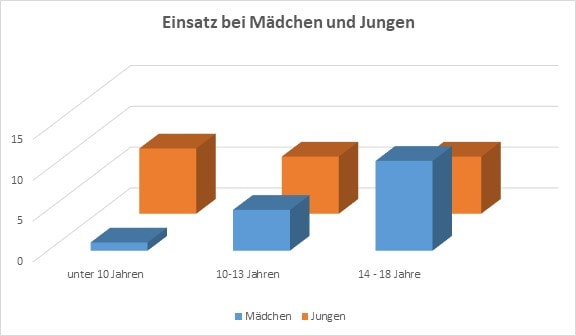
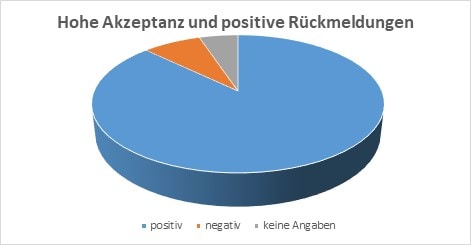



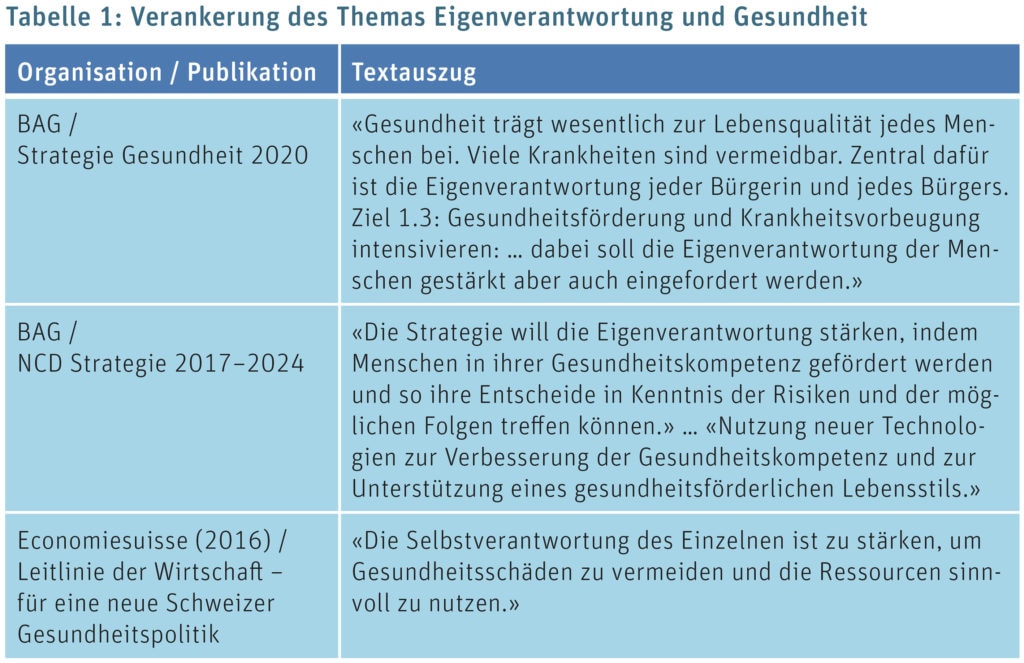

 Beiträge als RSS
Beiträge als RSS