Soziale Isolation wirkt sich negativ auf Wohlbefinden und Gesundheit aus. Kann hier künstliche Intelligenz Abhilfe schaffen? Können automatisierte Systeme soziale Beziehungen simulieren?
Soziale Beziehungen haben zahlreiche gut belegte Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und sogar die Mortalität (Holt-Lunstadt, Smith & Layton, 2010). Umgekehrt ist soziale Isolation ein wichtiger Risikofaktor für Gesundheitsprobleme und Mortalität (House, Landis & Umberson, 1988). Auch im Rahmen der von der BFH durchgeführten Befragung von 700 zuhause lebenden Menschen 70+ konnte gezeigt werden, dass mit der Häufigkeit von sozialen Beziehungen auch die Wahrscheinlichkeit einer hohen Lebenszufriedenheit zunimmt (Bennett & Riedel, 2010). Gleichzeitig wissen wir, dass Personen ab 75 Jahren in der Schweiz ein erhöhtes Risiko der sozialen Isolation aufweisen (Gazareth & Modetta, 2006).
Aufgrund der klar erwiesenen negativen Folgen sozialer Isolation besteht also ein gesellschaftliches Interesse daran, sozialer Isolation wirksam zu begegnen. Angesichts der demographischen Entwicklung und dem sich gleichzeitig abzeichnenden Fachkräftemangel ist aber einerseits von einer Zunahme der von sozialer Isolation bedrohten Personen auszugehen und andererseits unwahrscheinlich, dass soziale Kontakte durch Fachkräfte hergestellt werden können. Das Engagement von Freiwilligen wird deshalb in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Doch zugleich gewinnt auch die Frage an Bedeutung, welchen Beitrag zur Bekämpfung der sozialen Isolation computergesteuerte Systeme leisten können. Ist es möglich, die positiven Merkmale von zwischenmenschlichen Kontakten – zumindest annäherungsweise – durch automatisierte Systeme zu simulieren? Wenn ja, so eröffnete sich dadurch eine grosse Chance, sozial isolierte Personen an den positiven Effekten von sozialen Kontakten teilhaben zu lassen.
Affective Computing – Das Erkennen von menschlichen Emotionen
Als grosse Herausforderung bei der Simulation eines sozialen Gegenübers hat sich die Erkennung von menschlichen Emotionen erwiesen. Während wir aus der Psychologie wissen, dass Menschen kulturunabhängig Basis-Emotionen aufgrund der Mimik eines menschlichen Gegenübers identifizieren können (Ekman, 1999), so ist dies für computerbasierte Systeme ungleich schwieriger. Das «Affective Computing» hat sich dieser Herausforderung gestellt und kann erste Erfolge vorweisen. In diesem Zusammenhang haben sich auch die Fortschritte im Bereich Emotionserkennung auf der Basis der verwendeten Sprache als sehr bedeutsam erwiesen (Koolagudi & Rao, 2012). Unter Affective Computing wird Forschung verstanden, die intelligente Systeme dazu befähigen will, menschliche Emotionen erkennen und interpretieren zu können (Poria et al., 2017). Dies ist eine zentrale Voraussetzung, damit diese Systeme ein adäquates Gespräch mit einem Menschen führen können.
Eine konkrete Anwendung dieser Forschungsrichtung sind sogenannte Embodied Conversational Agents (ECA), animierte Computerpersonen, die so designt sind, dass sie sowohl äusserlich als auch von ihren Verhaltensweisen her einem Menschen gleichen. ECA agieren in der Regel sowohl verbal als auch non-verbal (z.B. durch Gesten; Ring et al., 2015). Sie sind affektiv intelligente Systeme, die beispielsweise in der Lage sind, Small Talk zu führen, mit ihrem menschlichen Gegenüber Spiele zu spielen und den Kontakt zu anderen Menschen zu stimulieren und initiieren. Schliesslich kann ein Conversational Agent auch die körperliche Aktivität eines Menschen fördern, was sich bekanntermassen positiv auf das emotionale Wohlbefinden auswirkt (Ring et al., 2015).
Eine Anwendung von Embodied Conversational Agents bei sozial isolierten Personen
Wie ECA nun zugunsten von sozial isolierten Personen eingesetzt werden können, soll anhand einer konkreten Interventionsstudie (Ring et al., 2015) illustriert werden. Bemerkenswert an der Vorgehensweise der beteiligten Forschergruppe ist, dass sie im ersten Schritt die konkrete Alltagssituation von sozial isolierten Personen näher untersuchten. So analysierten sie, über welche sozialen Kontakte diese Personen verfügten und welche Themen dort besprochen wurden. Zudem unterhielten sich die Forschenden mit Freiwilligen, die sozial isolierte ältere Menschen besuchen, um auch von ihnen typische Merkmale dieser sozialen Kontakte zu erfahren. Dabei zeigte sich, dass neben Small Talk insbesondere das Zuhören ein zentrales Element des sozialen Kontakts war.
Die Feldforschung wurde dann bei den teilnehmenden Personen zuhause durch ein sogenanntes „Wizard of Oz-Experiment“ (Dahlbäck, Jönsson & Ahrenberg, 1993) komplettiert. Dabei glauben die Teilnehmenden, dass sie ein autonomes Computer-System vor sich haben, welches tatsächlich aber aus Distanz von einem Menschen gesteuert wird. Die Forschenden sind so in der Lage zu erfahren, worüber die Nutzenden mit dem ECA sprechen. Auf der Basis dieser explorativen Voruntersuchung entwickelten die Forschenden einen ECA auf einem Touchscreen Computer. Dieser ECA verwendete eine synthetisierte Stimme und angemessenes non-verbales Verhalten wie Gesten, Nicken, Veränderungen der Körperhaltung und emotionsbezogene Mimik. Er verfügte zudem über Bewegungssensoren, um die Anwesenheit der Person zu erkennen und ein Gespräch initiieren zu können. Im Zeitalter von Siri mag vielleicht erstaunen, dass das Interface über Bildschirmberührung gestaltet wurde und nicht auf der Basis von Spracherkennung funktionierte. Die teilnehmenden älteren Menschen „sprachen“ nämlich in Form von vorgegebenen Sätzen und Redewendungen, welche sie durch Berühren des Bildschirms auswählten. Grund für diese eher konventionell anmutende Lösung ist offenbar, dass viele Spracherkennungs-Anwendungen bei älteren Menschen an Grenzen stossen.
Während einer Woche wurde der ECA dann bei sozial isolierten Personen eingesetzt. Dabei konnte einerseits mit einem quantitativen Messinstrument gezeigt werden, dass sich die berichtete Einsamkeit verringerte. Andererseits ergab die qualitative Analyse von Tagebuchdaten, dass die teilnehmenden Personen die ECA tatsächlich als sozial unterstützend wahrnahmen und als empathisch erlebten. Auch löste der ECA positive Emotionen aus, insbesondere durch das Erzählen humorvoller Geschichten. Diese Effekte wurden aber nur für diejenige ECA ermittelt, die sensorgestützt in der Lage waren, ein Gespräch zu initiieren. Mussten dagegen die Gespräche ausschliesslich von der sozial isolierten Person begonnen werden, so verschwanden auch die positiven Auswirkungen bezüglich berichteter Einsamkeit und positiver Emotionen.
Auch wenn die Untersuchungsanlage gewisse Schwächen aufweist (z.B. das Fehlen einer Kontrollgruppe), so zeigen diese Ergebnisse dennoch, welches Potenzial ECA im Zusammenhang mit sozial isolierten älteren Menschen haben. Zudem darf angenommen werden, dass mit der erfolgreichen Anwendung von Stimmerkennungssoftware noch grössere Effekte erzielt werden könnten als mit einer Touch-Screen Anwendung. Eine entscheidende Voraussetzung für eine gut akzeptierte ECA ist sicher die sorgfältige Anknüpfung am Alltag der betroffenen Personen durch vorgelagerte Feldforschung. Hier wird eine hervorragende Möglichkeit für die Zusammenarbeit von Computer Sciences und Sozialwissenschaften sichtbar.
Einschränkungen und Ausblick
Trotz der interessanten und auch ermutigenden Ergebnisse der zitierten Studie wurden auch Schwächen von ECA deutlich. So beurteilten Nutzende beispielsweise die limitierte Bandbreite von möglichen Gesprächsthemen, die vielen Repetitionen und den Mangel an Humor des ECA kritisch. Zieht man in Betracht, dass die Einsatzdauer der ECA lediglich eine Woche betrug, so müssen wir vermuten, dass ein längerfristiger Beziehungsaufbau zu einem ECA die Fähigkeit zu einer sehr viel variantenreicheren Gesprächsführung voraussetzen würde. Bezüglich der ebenfalls intendierten Stimulation von körperlicher Betätigung kam es auch zu bewusstem Vermeidungsverhalten von Personen. Zudem scheint die Verwendung des ECA bei den betroffenen Personen teilweise dazu zu führen, dass ihnen ihre soziale Isoliertheit bewusst wird, sie sich aber emotional davon zu distanzieren versuchen und deshalb auch den ECA abwerten. Bereits erwähnt wurde, dass die meisten Stimmerkennungsprogramme Mühe haben, ältere Menschen zu verstehen. Dies ist auch deshalb eine wichtige Einschränkung, weil Sehbehinderungen insbesondere bei hochaltrigen Menschen sehr häufig vorkommen und die stimmliche Kommunikation dadurch umso wichtiger wird, ganz abgesehen davon, dass sie die Bedienung eines Touch-Screens erschweren.
Eine interessante Entwicklungsmöglichkeit bietet sich in der Verbindung zwischen Affective Computing und Positiver Psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). Die Positive Psychologie hat in den letzten zwei Jahrzehnten viel Evidenz dazu hervorgebracht, dass das Richten der Aufmerksamkeit auf das, was ein Leben lebenswert macht, Gesundheit und Wohlbefinden positiv beeinflusst. Die meisten Menschen müssen diese Aufmerksamkeit allerdings regelmässig üben und dazu könnten ECA – gerade auch bei sozial isolierten älteren Menschen – einen wichtigen Beitrag leisten.
Literatur
Bennett, P. D. J., & Riedel, P. D. M. (2013). Was beeinflusst die Lebenszufriedenheit im hohen Alter? Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 46(1), 21–26. https://doi.org/10.1007/s00391-012-0457-5
Dahlbäck, N., Jönsson, A., & Ahrenberg, L. (1993). Wizard of Oz studies — why and how. Knowledge-Based Systems, 6(4), 258–266. https://doi.org/10.1016/0950-7051(93)90017-N
Ekman, P. (1999). Basic Emotions. In T. Dalgleish & M. J. Power (Hrsg.), Handbook of Cognition and Emotion (S. 45–60). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/0470013494.ch3
Gazareth, P., & Modetta, C. (2006). Intégration et réseaux sociaux. Déterminants de l’isolement social en Suisse. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLOS Medicine, 7(7), e1000316. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316
House, J. S., Landis, K. R., & Umberson, D. (1988). Social relationships and health. Science, 241(4865), 540–545. https://doi.org/10.1126/science.3399889
Koolagudi, S. G., & Rao, K. S. (2012). Emotion recognition from speech: a review. International Journal of Speech Technology, 15(2), 99–117. https://doi.org/10.1007/s10772-011-9125-1
Poria, S., Cambria, E., Bajpai, R., & Hussain, A. (2017). A review of affective computing: From unimodal analysis to multimodal fusion. Information Fusion, 37(Supplement C), 98–125. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2017.02.003
Ring, L., Shi, L., Totzke, K., & Bickmore, T. (2015). Social support agents for older adults: longitudinal affective computing in the home. Journal on Multimodal User Interfaces, 9(1), 79–88. https://doi.org/10.1007/s12193-014-0157-0
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive Psychology: An Introduction. In Flow and the Foundations of Positive Psychology (S. 279–298). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8_18
 Create PDF
Create PDF







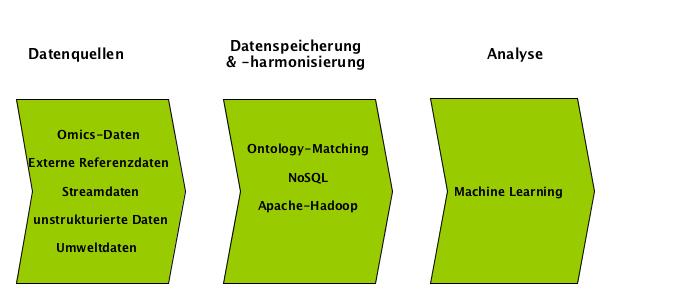
 Beiträge als RSS
Beiträge als RSS